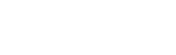Agrégationskolloquium 2015 "Deiktische Ausdrücke im Deutschen — Auffälligkeiten, Probleme, Analysen", 27.-28. März 2015 in Paris & Villetaneuse
Résumé
Mein Vorschlag schreibt sich in die im Call for Paper genannte Perspektive der diachronen Grammatik ein. Ich möchte mich auf deutschsprachige Grammatiken aus dem Zeitraum 1750-1850 konzentrieren, da es sich um eine Periode handelt, wo eine grundlegende Umorientierung in der Analyse von – modern gesprochen – exophorischen Deiktika zu beobachten ist, die das Thema des Kolloquiums sind. Mit den Organisatorinnen verstehe ich unter diesen Deiktika „im engeren Sinn“ (s. Call for Papers) Ausdrücke, deren Referenten nur in Bezug auf die aktuelle, eventuelle fiktive Sprechsituation – involvierte Gesprächspartner, lokal-temporaler Rahmen – identifiziert werden können. In meiner Untersuchung werde ich mich auf die heute im Allgemeinen unstrittigen Formen konzentrieren, nämlich exophorische Personalpronomina, Adverbien, Adjektive. Für die Beschreibung und Analyse der Entwicklung in dem genannten Untersuchungszeitraum muss kurz auf die ihr zu Grunde liegende latein-griechische Grammatikographie sowie auf die Anfänge der deutschen Grammatikographie eingegangen werden. Spätestens in der Téchnē grammatikē von Dinosysius Thrax’ (2.-1 Jh. vor u. Z.) findet man eine Unterscheidung zwischen den Personalpronomina der 1. und 2. Person auf der einen Seite und denen der 3. Person auf der anderen. In der Übersetzung J. Lallots lautet die entsprechende Textstelle, dass die Pronomina der 1. und 2. Person « donnent à voir les désignés » (Lallot, 1989 : 59, kursiv F.S.-D.). Diese Perspektive, in der die „Zeige“-Funktion dieser Pronomina expliziert wird (vgl. auch Lallot 1989: 198), wird in der späteren lateinischen Tradition zum großen Teil durch die Funktion der Substitution überlagert, die allen Pronomina unterschiedslos zugesprochen wird (cf. Briu, 2004). So definiert der hier zentrale Donatus (4. Jh., unserer Zeitrechnung) in seiner Ars Minor das Pronomen als einen „Redeteil, der an die Stelle eines Nomens gesetzt wird, fast soviel wie dieses bedeutet und manchmal die Person enthält“ (übers. von Autorin). Diese Tradition ist auch ausschlaggebend für die Anfänge der deutschsprachigen Grammatikographie (Ende 16. Jh.), wo bis in die Mitte des 18. Jhs. ebenfalls die Substitutionstheorie, die die deiktische Perspektive weitgehend unberücksichtigt lässt, dominiert (vgl. Barbarić 1981, I: 730-735). Spätestens 1754 wird jedoch in Aichinger’s Versuch einer teutschen Sprachlehre (vgl. 1754: 122-123) die Vorstellung einer rein substitutiven Funktion der Pronomina vehement kritisiert, eine Position, deren Stärkung in den folgenden Jahrzehnten auf dem Hintergrund unterschiedlicher theoretischer Ansätze zu beobachten ist und auch auf andere Deiktika erweitert wird. Zentral in dieser Entwicklung erweisen sich allgemein-philosophische Ansätze, besonders sensualistischer und transzendental-kritischer Ausprägung um die Jahrhundertwende, da dort der Dialogsituation und handlungskommunikativen Aspekten eine fundamentale Rolle für das Verständnis der Sprache an sich zugesprochen wird, so z.B. bei Vater (1801) und Bernhardi (1801-1803, 1805). Das Hauptaugenmerk liegt jedoch bei ihnen noch auf der Funktionsweise deiktischer Pronomina. Eine sprachtheoretische Systematisierung dieser Perspektive entwickelt dann K.F. Becker, der für alle Sprachzeichen eine grundlegende Opposition zwischen den dem Sein zugeordneten « Begriffswörtern » und den der Aktivität zugeordneten « Formwörtern » annimmt, zu denen deiktische Pronomina, Adverbien und Adjektive gehören (vgl. z.B. Becker 18412 : 200). In unserem Vortrag möchten wir diese Entwicklung erklärend nachzeichnen, um abschließend einen Ausblick auf den erneuten weitgehenden „Verlust“ dieser funktional-pragmatischen Perspektive auf Deiktika im 2. Drittel des 19. Jhs. (z.B. Grimm 1837, Bd. 4) und deren Gründe anzudeuten.
Domaines
Linguistique| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|
Loading...